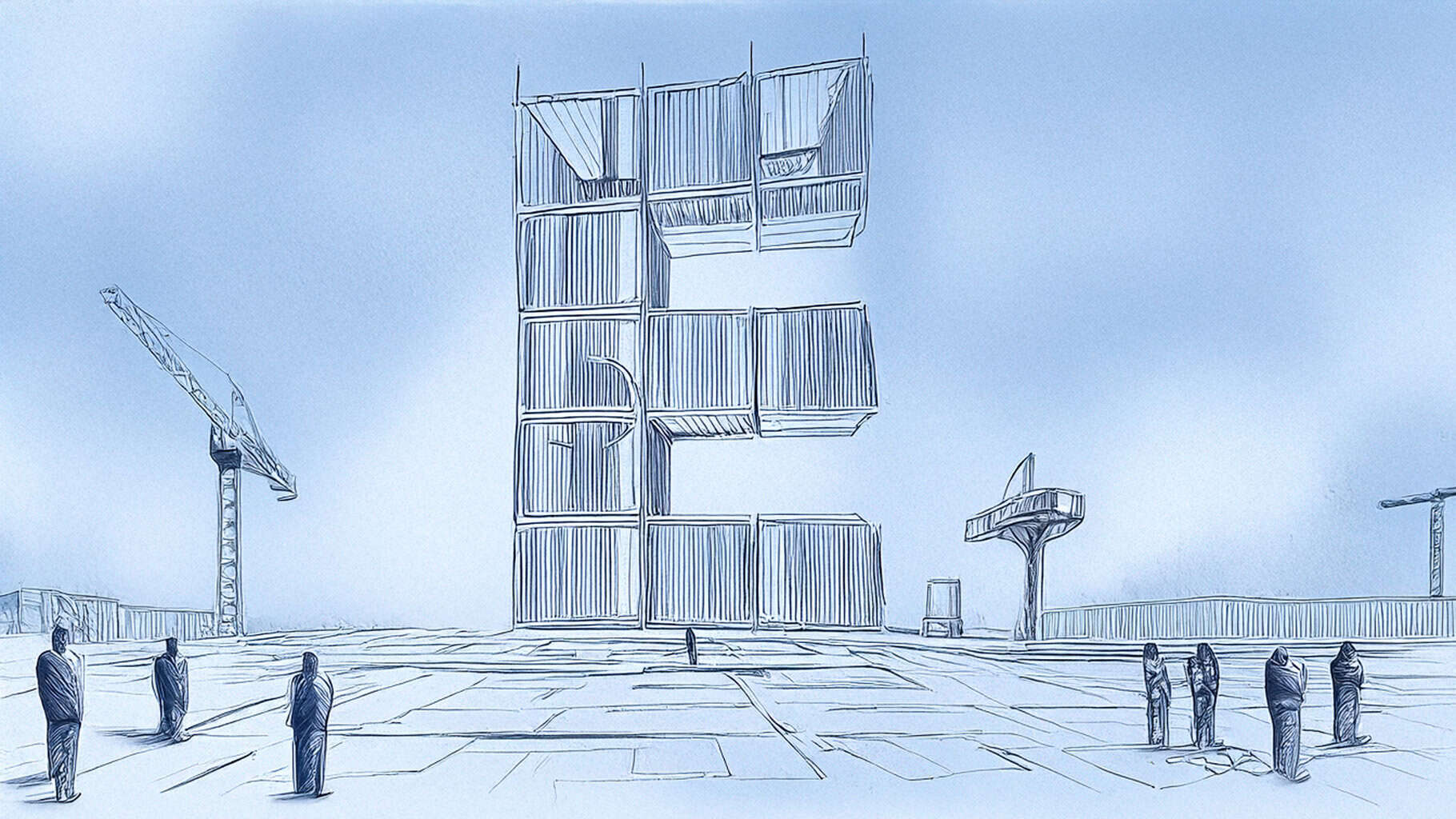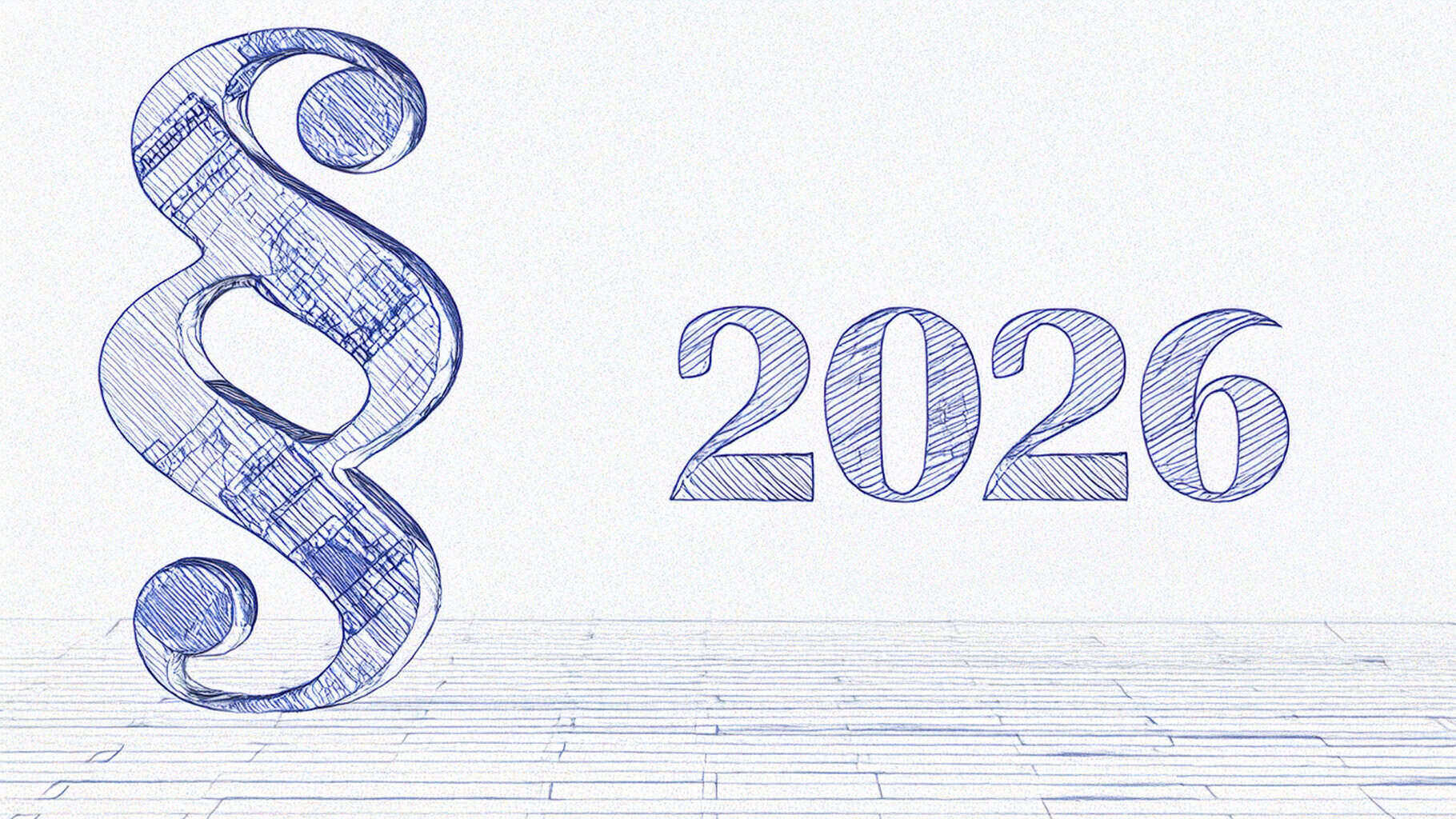Ein Fall aus der Praxis: Ein Anlagenbauer hat mit einem internationalen Industriekonzern einen EPC-Vertrag über den Komplettbau einer Rohstoff-Förder- und Verarbeitungsanlage in der Größenordnung eines dreistelligen Millionenbetrags abgeschlossen. Bei einem EPC-Vertrag tritt der Anlagenbauer als Generalunternehmer auf, der Planung (Engineering), Beschaffung (Procurement) und Bau (Construction) des Projektes teilweise selbst und teilweise mithilfe von Subunternehmen ausführt.
Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe
Der Generalunternehmer (GU) trägt also das volle Risiko, das er bei der Vertragsgestaltung entsprechend einkalkulieren muss. Doch dann kommt es zu Verzögerungen beim Start des Projekts, die der GU nicht zu verantworten hat. Und genau zu dieser Zeit explodieren die Kosten innerhalb weniger Monate und damit die Ausgaben für etliche Leistungen. Zudem kann ein Subunternehmen erfolgreich höhere Preise durchsetzen.
Die Folge: Die tatsächlichen Kosten überschreiten erheblich die vorher kalkulierten, so dass der GU bei dem vereinbarten Komplettpreis nicht nur keinen Gewinn macht, sondern ein Defizit in der Größenordnung eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags zu verkraften hat. Die Geschäftsleitung steht unter enormem Druck. Sie will deshalb Nachverhandlungen, weil sich in der Zwischenzeit die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit geändert haben. Noch während das Projekt läuft, fordert sie diesen Differenzbetrag von dem Industriekonzern ein. Doch der weigert sich, für die Mehrkosten aufzukommen.
Die gesamte Prozesskette durchleuchten
Wie sieht in diesem Fall eine erfolgreiche Claim-Verhandlung aus? Das Stichwort dazu heißt: End-to-End-Verhandlungsoptimierung. Bei solchen großen, komplexen Nachverhandlungen empfiehlt es sich, die gesamte Prozesskette zu durchleuchten. Das heißt:
- erstens von der Entwicklung, dem Einkauf, der Produktion bis zum Vertrieb Transparenz zu schaffen hinsichtlich der Ursachen der Kostenexplosion
- zweitens die Verhandlungs- und Vertragssituation durch ein funktionsübergreifendes Projektteam bewerten zu lassen und
- drittens auf dieser Basis eine ganzheitliche Verhandlungsstrategie zu entwickeln.
Das Ziel besteht darin, zusätzliche Ansprüche durchzusetzen (im Vertrieb) und ungerechtfertigte Ansprüche abzuwehren (in der Beschaffung). Erforderlich dafür ist auch ein Mentalitätswandel: Denn der GU muss sich trauen, diesen EPC-Vertrag wieder aufzumachen. Bei seinem Vertrieb besteht in diesem Punkt jedoch verständlicherweise eine gewisse Scheu, weil dieser es ja war, der den Vertrag ausgehandelt hat.
Erster Ansatzpunkt: Einkauf
Claim-Management umfasst die strategische und systematische Bearbeitung von Ansprüchen, die sich aus Verträgen ergeben. Etwa weil der Auftraggeber nach Vertragsabschluss noch Änderungen vorgenommen hat in Bezug auf den Projektumfang oder die technischen Spezifikationen. Und der Subunternehmer Abweichungen in der Qualität oder Quantität der erbrachten Leistungen gegenüber den vertraglichen Vereinbarungen vorgenommen hat.
Zum einen geht es also darum, den Subunternehmer (Lieferanten) mit guten Begründungen dazu zu bringen, seine Forderungen zu reduzieren und weitere Nachforderungen bis zur Übergabe der Anlage auszuschließen. Dazu ist es nötig, seine Interessen und Anreizstrukturen zu verstehen. Ist es kein einmaliges Projekt, bei dem der Lieferant zum Zuge kommt, ist es häufig schon mit dem Hinweis getan, dass ein Entgegenkommen in diesem Fall auch bei zukünftigen Projekten belohnt wird. Andernfalls man dann alternative Anbieter suchen werde.
Zweiter Ansatzpunkt: Vertrieb
Ähnliche Möglichkeiten gibt es auch im Vertrieb. Wie bei vielen Projekten handelt es sich in diesem Fall nicht um ein einmaliges Geschäft. Der internationale Industriekonzern ist häufig Kunde, weil er ähnliche Anlagen in vielen Teilen der Welt einsetzt. Die Lösung für den Vertrieb ist in diesem Fall ein Pain/Gain-Share-Modell vorzuschlagen, um das finanzielle Risiken und mögliche Gewinne zu teilen. Denn die Wirtschaftslage kann sich ja durchaus wieder ändern und die Preise, die jetzt das Projekt verteuern, können wieder fallen. Dieses Modell zur Risiko- und Chancenteilung fördert eine stärkere Zusammenarbeit, da sowohl Generalunternehmer wie der Auftraggeber das gemeinsame Interesse haben, die Kosten zu kontrollieren und die Leistung zu optimieren.
Dabei hilft es, positive und negative Anreize in der Verhandlung bewusst einzusetzen, unabhängig von dem aktuellen Vertrag, um den Nachforderungen Gewicht zu verschaffen. Etwa dass man in Zukunft noch stärker die Bedürfnisse des Kunden berücksichtigen werde, um die Partnerschaft zu stärken. Aber sollte der Kunde nicht nachgeben, dass man sich auch andere strategische Partner suchen könne.
Das operative Vorgehen
- Schaffen einer klaren Führungsstruktur für die Verhandlung. Dabei sollte die Rolle der Geschäftsleitung auf die Festlegung von Richtlinien beschränkt sein und die operative Verantwortlichkeit an das Verhandlungsteam delegiert werden.
- Das Verhandlungsteam crossfunktional zusammensetzen, die Rollen und Verantwortlichkeiten eindeutig definieren.
- Die Verhandlungsziele auf Basis der erarbeiteten Strategie klar festgelegen, einschließlich von Ankerforderungen, Mindestzielen und möglichen Eskalationsschritten.
- Zur Vorbereitung Szenarien anhand eines detaillierten Verhandlungsleitfadens simulieren und eine kohärente Storyline entwickeln, um die interne Kommunikation zu steuern und die Gegenpartei strategisch zu lenken.
- Das Verhandlungsteam mental richtig einstellen: Rollenspiele helfen, die eigene Stress-Resilienz zu erhöhen und im Fall von Eskalationsschritten bei einer kontrollierten Konfrontation Ängste vor der Verärgerung des Kunden zu reduzieren.
- Eine zentrale Kommunikationsplattform einrichten, um den strukturierten und transparenten Austausch von Informationen und anstehenden Entscheidungen sowie einen gemeinsamen Wissensstand über Verhandlungsverlauf und aktuelle Entwicklungen zu erreichen.
Fazit: Gestärkte Partnerschaft
Trotz des vereinbarten Festpreises im EPC-Vertrag konnte der Anlagenbauer am Ende den Großteil seiner Forderungen durchsetzen. Es gelang nicht nur, eine Vertragsanpassung gegenüber dem Industriekonzern mit einem wesentlich höheren realistischen Preis durchzusetzen, sondern auch die Forderungen des Subunternehmers zu reduzieren beziehungsweise zu deckeln. Im Endergebnis hat
Die Negotiation Advisory Group (NAG)
Die NAG hat als führende Verhandlungsberatung in Europa mit über 50 internationalen Expertinnen und Experten bislang mehr als 2.900 Verhandlungsprojekte durchgeführt und verhandelt jährlich ein Volumen von derzeit etwa 27 Milliarden Euro. Zu ihren Kunden zählen internationale Konzerne sowie große mittelständische Unternehmen. Geschäftsführerin ist Katharina Weber, die seit der Gründung maßgeblich die NAG entwickelt hat, zuletzt als Teil des erfahrenen Management Teams in der Funktion der COO. https://www.n-advisory.com/