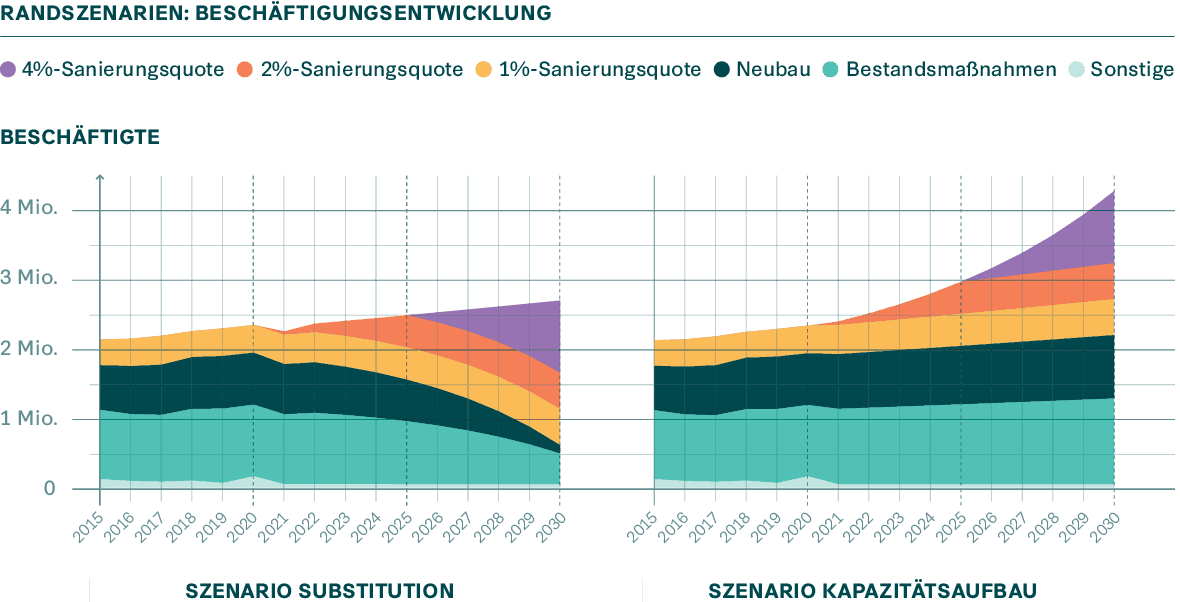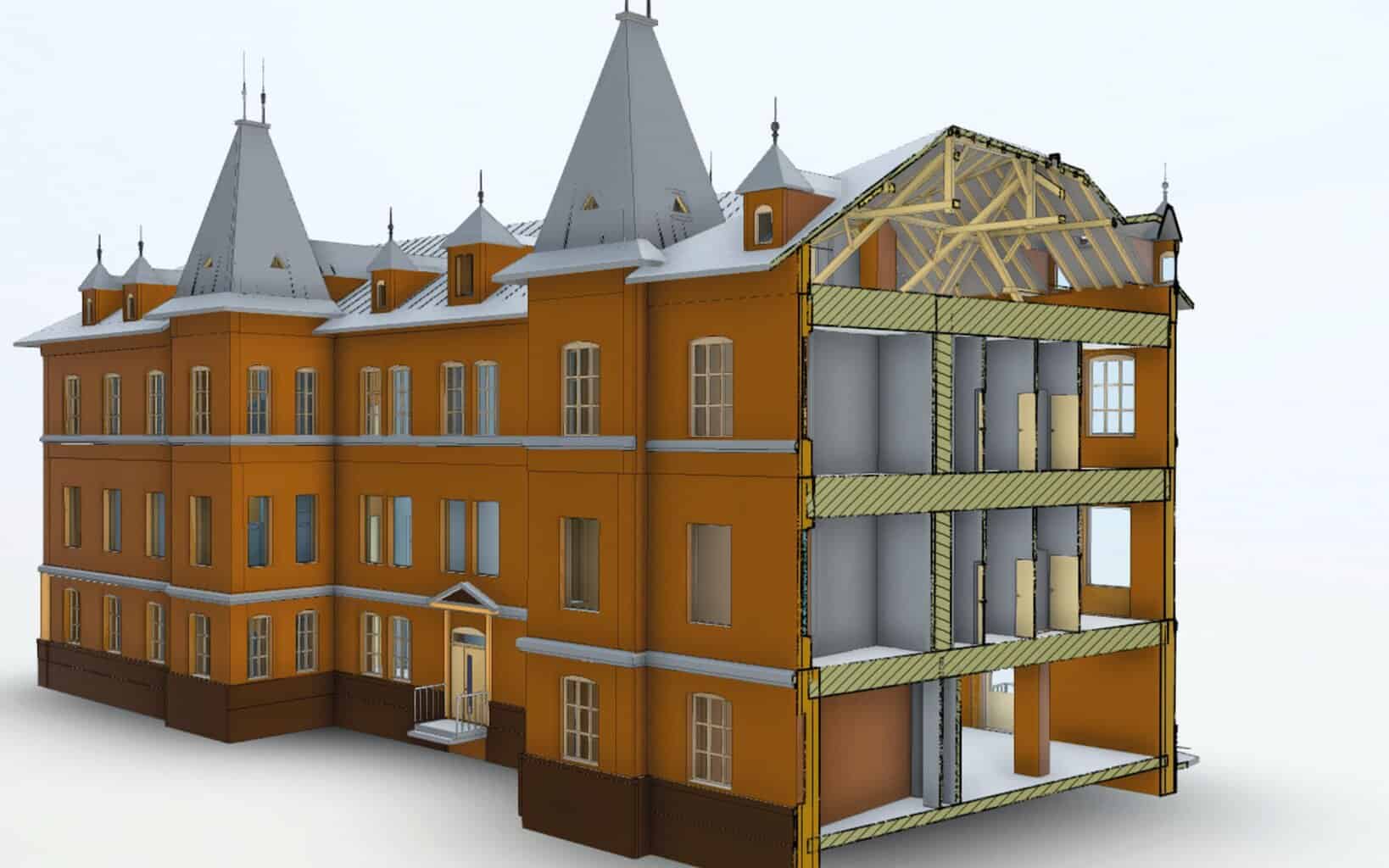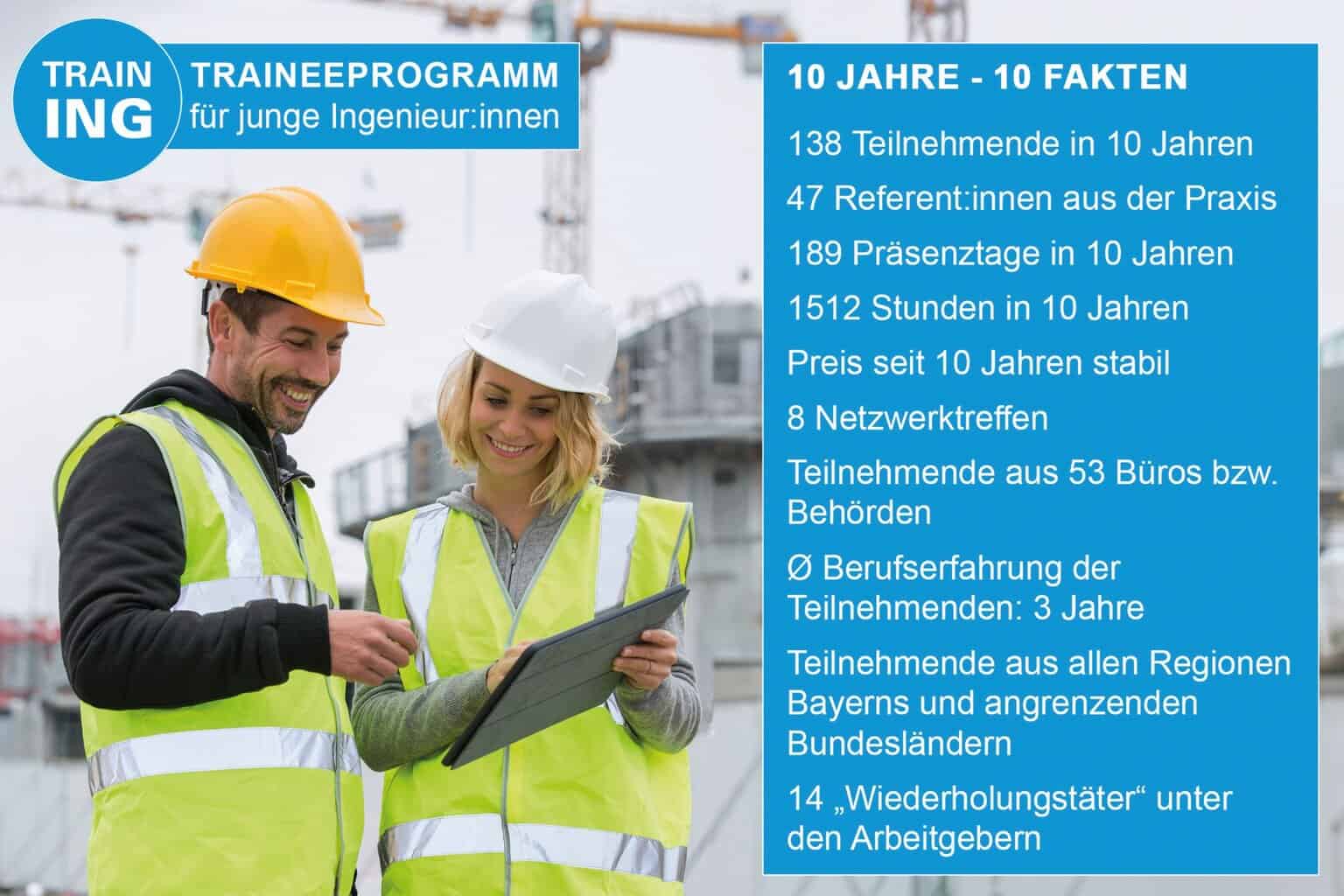Dazu gehören unter anderem die Feststellung von Qualifikationen, die Berufsaufsicht, die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie Sach- und Fachkundeprüfungen. Die funktionale Selbstverwaltung durch Kammern hat sich dabei in Deutschland in langer Tradition bewährt – sie ist dem Grunde nach unverzichtbar.
Politik
Start » Politik
Die berufliche Selbstverwaltung!
Die berufliche Selbstverwaltung!
Plädoyer für ein starkes Kammerwesen (auch) für Ingenieure!
Plädoyer für ein starkes Kammerwesen (auch) für Ingenieure!
Die Gesetzgeber auf Bundes- oder Landesebene haben den Kammern der Freien Berufe, den Industrie- und Handelskammern oder auch den Handwerkskammern als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung eine Vielzahl hoheitlicher Aufgaben übertragen.
Die Gesetzgeber auf Bundes- oder Landesebene haben den Kammern der Freien Berufe, den Industrie- und Handelskammern oder auch den Handwerkskammern als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung eine Vielzahl hoheitlicher Aufgaben übertragen.
Dazu gehören unter anderem die Feststellung von Qualifikationen, die Berufsaufsicht, die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie Sach- und Fachkundeprüfungen. Die funktionale Selbstverwaltung durch Kammern hat sich dabei in Deutschland in langer Tradition bewährt – sie ist dem Grunde nach unverzichtbar.
Berufliche Selbstverwaltung bedeutet grundsätzlich, dass sich Fachleute um die Belange von Fachleuten kümmern. Ansonsten müsste eine Behörde mit – unter Umständen – fachfremdem Personal tätig werden. Kammern entlasten also den Staat und sind zugleich Ausdruck von Fachlichkeit. Die berufliche Selbstverwaltung entspricht dabei auch dem Subsidiaritätsprinzip. Das aus dem Lateinischen stammende Wort „Subsidiarität“ bedeutet in diesem Zusammenhang sinngemäß „zurücktreten“ oder „untergeordnet sein“. Kern dieses Prinzips ist es daher, einer untergeordneten Organisationseinheit gegenüber einer übergeordneten Behörde das notwendige Maß an Unabhängigkeit zu sichern. Es geht um die Kompetenzverteilung zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen. Im politischen System bedeutet Subsidiarität also, dass der Staat immer dann von einer Aufgabe zurücktritt, wenn diese Aufgabe von einer „untergeordneten“ Organisation besser erfüllt werden kann. Das Subsidiaritätsprinzip bildet die institutionelle Grundlage föderalistisch aufgebauter Staaten.
Dieser Artikel ist exklusiv für Mitglieder der Ingenieurkammern zugänglich. Bitte melden Sie sich an, um den vollständigen Beitrag zu lesen.
Warum sich ein Login für Kammermitglieder lohnt:
Ihre Login-Daten verwaltet die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.