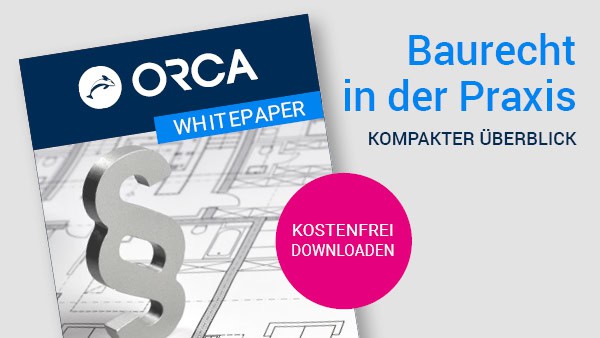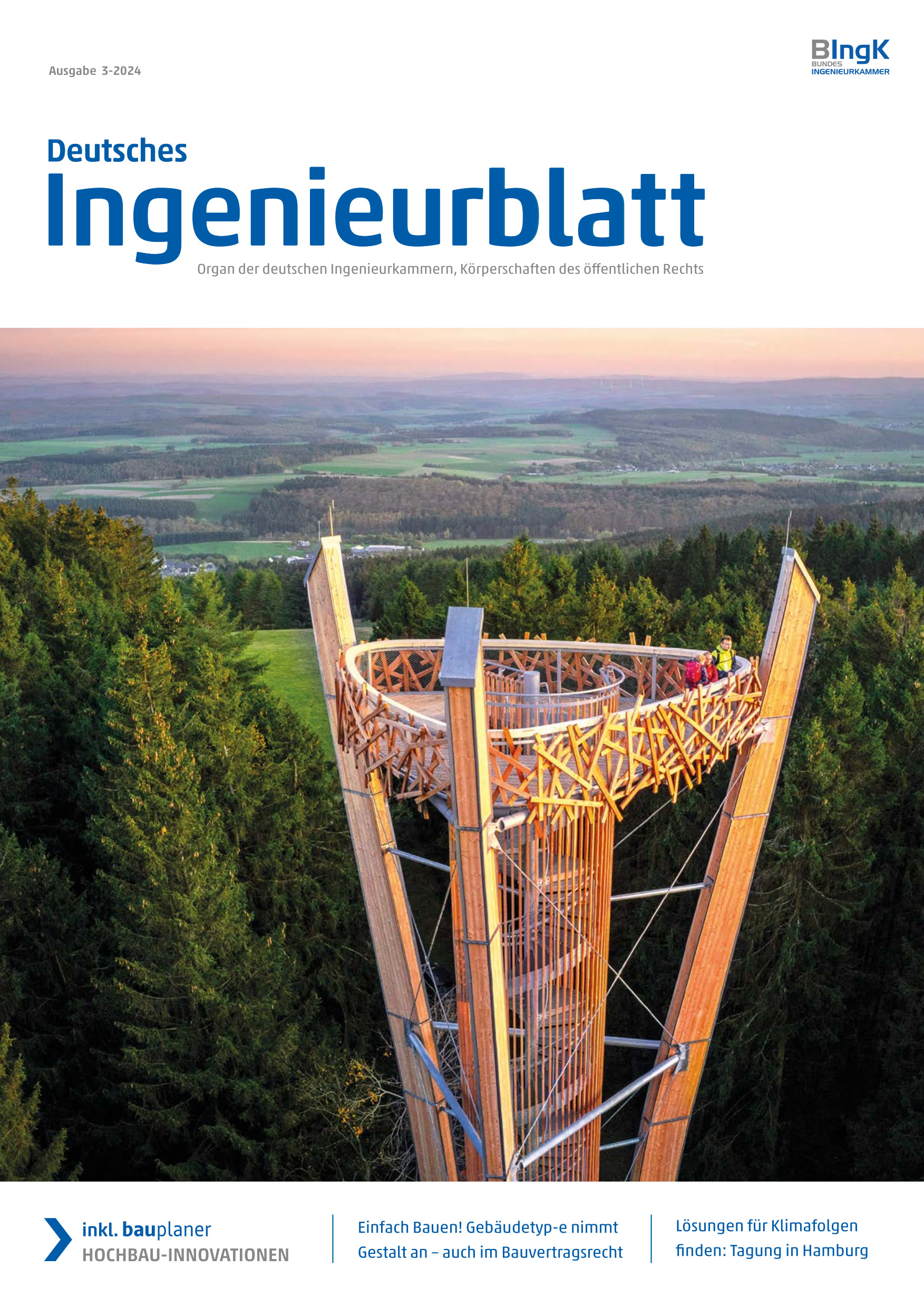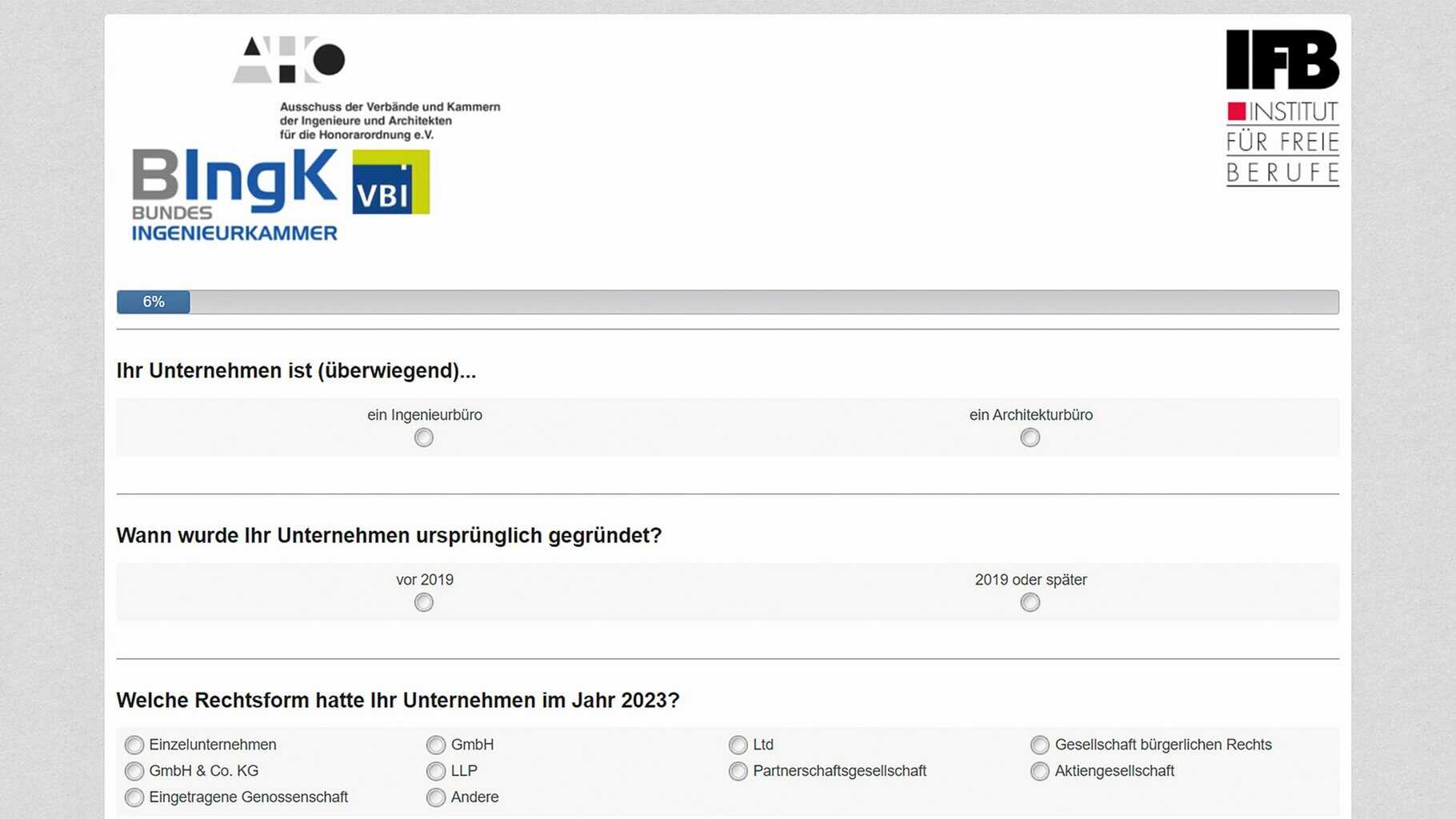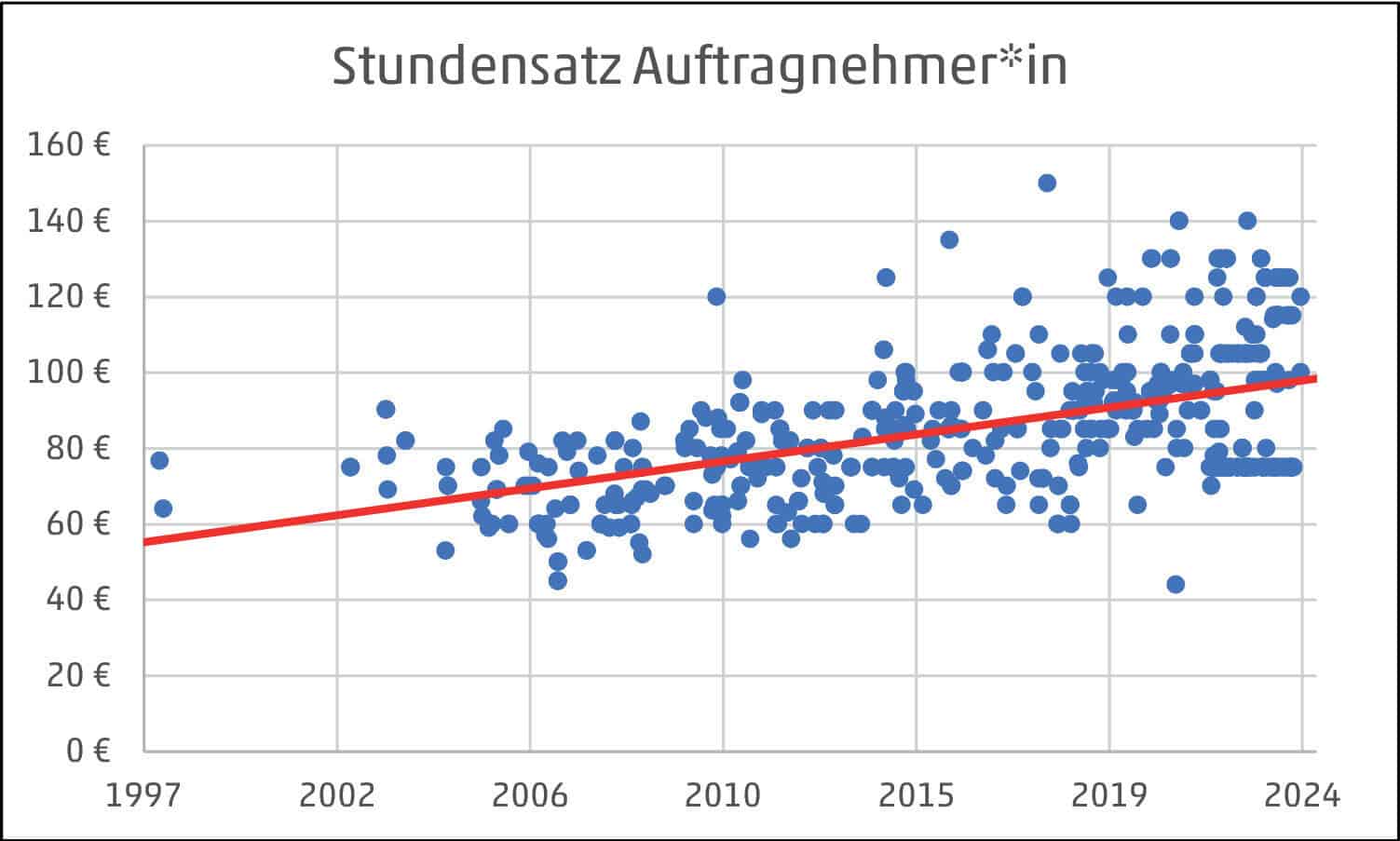Seit seiner Gründung im Jahr 1852 sammelt, erforscht und zeigt das Germanische Nationalmuseum Zeugnisse der Hoch- und Alltagskultur. Darunter befinden sich Gemälde und Skulpturen, Möbel, historische Kleider und Schmuck, Spielzeug, aber auch archäologische Funde und wissenschaftliche Instrumente. Der Bestand umfasst circa 1,4 Millionen Objekte, die meisten davon untergebracht in Depots. Werden diese Räumlichkeiten zunächst mit einer „Abstellfläche“ assoziiert, so sind sie doch viel mehr: „Depots sind Wissensspeicher zur nachhaltigen Kunst- und Kultursicherung, also das materielle Gedächtnis eines Museums“, erklärt Florian Kutzer, Architekt und Leiter der Abteilung Baukoordination des Germanischen Nationalmuseums. Im Falle von Nürnberg stießen die vorhandenen Depots irgendwann an ihre Grenzen. Hinzu kam die geplante Generalsanierung der bestehenden Gebäude des Architekten und Designers Sep Ruf, die eine temporäre Verlegung und Lagerung der ausgestellten Objekte notwendig macht.

Wohin mit der Erweiterung?
Beispiele wie die Depotgebäude des Museums Boijmans Van Beuningen in Rotterdam oder des Tiroler Landesmuseums in Hall zeigen, dass Zweckbauten durchaus einen hohen gestalterischen Anspruch erfüllen können. Entsprechende Szenarien spielte man auch in Nürnberg durch – vom Ankauf eines Gebäudes, dem externen Neubau im Stadtgebiet bis hin zu einem Tiefbau auf dem Museumsgelände. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile entschied sich der Bauherr schließlich für letztere Variante. „Das bedeutete natürlich mehr Aufwand, als wenn man irgendwo einen Hochbau errichtet hätte“, berichtet Kutzer. „Es brachte aber auch große Vorteile mit sich, die letzten Endes den Ausschlag gaben: Erstens sind die Wege kurz, wenn ein Objekt transportiert, angesehen oder untersucht werden soll. Zweitens wird der Sicherheitsaufwand reduziert, da sich der Zugang auf dem Museumsgelände befindet, das ohnehin kontinuierlich überwacht und gesichert wird. Und drittens taucht das Gebäude 11,60 Meter tief in das Grundwasser ein. Durch dessen konstante Temperatur zwischen 16 und 18 Grad Celsius wird auch jene innerhalb des Depots konstant gehalten. Der Energieaufwand ist entsprechend gering und damit kosten- und umweltschonend.“
Dieser Artikel ist exklusiv für Mitglieder der Ingenieurkammern zugänglich. Bitte melden Sie sich an, um den vollständigen Beitrag zu lesen.